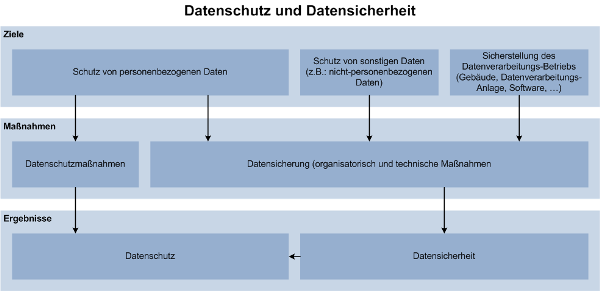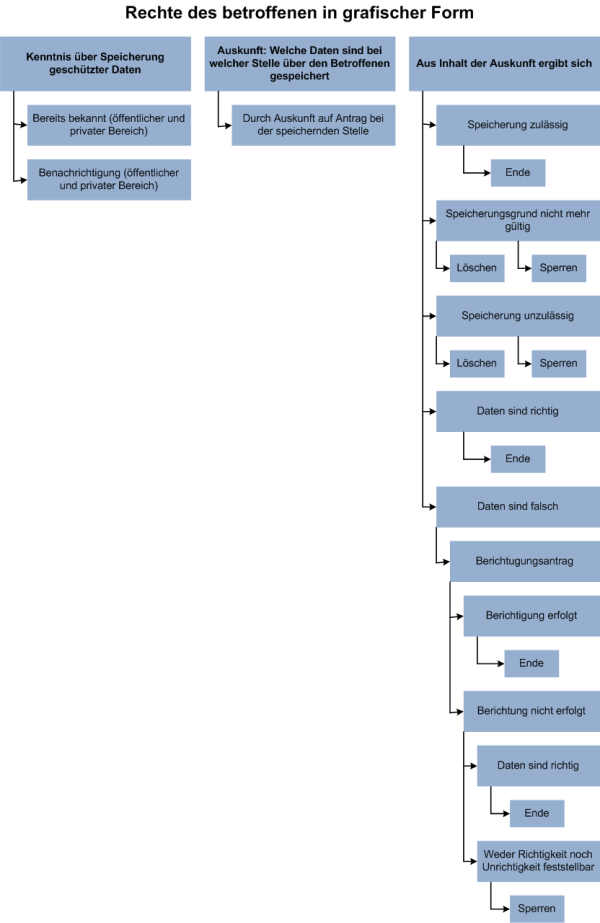Einführung - Datenschutz und Datenschutzbeauftragter


Was hat ein Datenschutzbeauftragter mit dem Datenschutz zu tun?
 Die Geschichte des Datenschutzes ist eine noch sehr kurze Geschichte. Dies
steht im direkten Zusammenhang mit der erst in jüngerer Zeit scheinbar
unaufhaltsam voranschreitenden technischen Entwicklung im Bereich der
Informationstechnologie. Erste Überlegungen zum Datenschutz kamen Anfang der
60 Jahre auf, als man sich bewusst wurde, dass der zunehmenden Möglichkeit
der technischen Datenverarbeitung die Schaffung beschränkender Bestimmungen
einhergehen muss, damit die schutzwürdigen Belange des Einzelnen bei der
Verarbeitung seiner Daten nicht beeinträchtigt werden.
Die Geschichte des Datenschutzes ist eine noch sehr kurze Geschichte. Dies
steht im direkten Zusammenhang mit der erst in jüngerer Zeit scheinbar
unaufhaltsam voranschreitenden technischen Entwicklung im Bereich der
Informationstechnologie. Erste Überlegungen zum Datenschutz kamen Anfang der
60 Jahre auf, als man sich bewusst wurde, dass der zunehmenden Möglichkeit
der technischen Datenverarbeitung die Schaffung beschränkender Bestimmungen
einhergehen muss, damit die schutzwürdigen Belange des Einzelnen bei der
Verarbeitung seiner Daten nicht beeinträchtigt werden.
Nach umfangreichen Erörterungen wurde am 01. Februar 1977 die Erstfassung
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) im Bundesgesetzblatt verkündet und trat
am 01. Januar 1979 umfassend in Kraft. Zuvor hatten bereits einzelne
Bundesländer eigene Landesdatenschutzgesetze geschaffen.
In der Folgezeit wurde der Datenschutz sowohl durch die weitere technische
Entwicklung als auch durch die den Datenschutz präzisierende und
fortschreibende Rechtsprechung der Gerichtsbarkeit geprägt. Hinzu kam ein
gewandeltes Rechtsempfinden der Bürger, was sich auch deutlich durch die
Aufnahme des Grundrechts auf Datenschutz in den Landesverfassungsgesetzen
der neuen Bundesländer gezeigt hat.
Aber auch über die nationalen Landesgrenzen hinaus, hat sich gezeigt, dass
die immer mehr zunehmende wirtschaftliche Verflechtung einen Datenfluss
bewirkt, der einer zumindest europaeinheitlichen Regelung bedarf.
Gleichfalls arbeitet die nationale Gesetzgebung aktuell an einem moderneren
Datenschutzgesetz. Ziel soll sein, das Datenschutzrecht zu vereinfachen, es
klarer und verständlicher zu regeln, die Selbstbestimmung der in ihrem
Persönlichkeitsrecht betroffenen Person zu stärken und die Selbstregulierung
der sog. verantwortlichen Stelle weiter auszubauen. Ferner soll der
Datenschutz auf die künftig zu erwartenden Risiken der
informationstechnischen Entwicklung ausgerichtet werden.
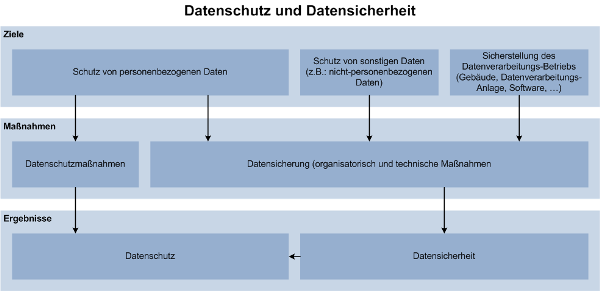
Bestehende Rechtsquellen zum Datenschutz (Auszug)
Verfassungsrecht
Eine der wichtigsten datenschutzrechtlichen Vorgaben
ist das Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgericht aus dem Jahr 1983.
Gegenstand dieser Entscheidung war die zwangsweise Erhebung von
personenbezogenen Daten. Hier hat das Bundesverfassungsgericht dem Einzelnen
als Ausprägung des verfassungsrechtlich verankerten allgemeinen
Persönlichkeitsrechts ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung
zugestanden. Es soll dem Einzelnen demnach grundsätzlich möglich sein,
selbst zu bestimmen, wann und wie viel andere von ihm erfahren. Dieses Recht
auf informationelle Selbstbestimmung dient dem Recht auf Erhaltung der
Privatsphäre und soll zugleich verhindern, dass eine zunehmende
"Überwachung" durch die Stellen in Staat und Wirtschaft eintritt. Es soll
das Abwehrrecht des Einzelnen gegen jede Form der Datenverarbeitung
einschließlich der Datenerhebung und Datennutzung sein.
Einschränkungen des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung sind nur
aufgrund der Bestimmungen des BDSG oder einer anderen Rechtsvorschrift
zulässig, vgl. § 4 Abs. 1 BDSG. Eine andere Rechtsvorschrift ist nur dann
eine ausreichende Rechtsgrundlage, wenn diese die Verarbeitung
personenbezogener Daten ausdrücklich für zulässig erklärt. Die
einschränkende Rechtsvorschrift muss den vom Bundesverfassungsgericht im
Volkszählungsurteil vorgegebenen Kriterien entsprechen.
- Eine solche Rechtsvorschrift muss daher den Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit beachten. Dieser Grundsatz fordert nicht nur die
Prüfung, ob eine Maßnahme (z.B. die Volkszählung) erforderlich ist, sondern
insbesondere, ob ein Mittel im Verhältnis zum angestrebten Zweck noch
verhältnismäßig ist.
- Die Voraussetzungen für die Einschränkung des Grundrechts und deren Umfang
für den Bürger müssen erkennbar geregelt sein, also dem Gebot der
Bestimmtheit und Normenklarheit entsprechen. Dies bewirkt gerade im
Datenschutzbereich den Erlass einer Vielzahl von bereichsspezifischen
Gesetzen.
- Nur das erforderliche Minimum an Daten darf verlangt werden, vgl. auch §
3a BDSG.
- Die Daten dürfen grundsätzlich nur für den Zweck verwendet werden, für den
sie erhoben oder erfasst wurden. Dieser Zweckbindungsgrundsatz ist
essentieller Bestandteil eines wirklich effizienten Datenschutzes.
- Der Gesetzgeber muss durch ergänzende Vorkehrungen dafür sorgen, dass auch
bei der Organisation und beim Verfahren des Umgangs mit personenbezogenen
Daten auf die Rechte des Einzelnen Rücksicht genommen wird. Hierzu gehört
zum Beispiel der Grundsatz der Datenerhebung beim Betroffenen, die
Installation einer wirksamen Kontrolle von Betroffenenrechten und
schließlich die Vorgaben zur Datensicherung.
Bundesdatenschutzgesetz und Landesdatenschutzgesetze
Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) regelt den Umgang mit personenbezogenen
Daten. Dazu stellt es die Voraussetzungen auf, unter denen personenbezogene
Daten erhoben, verarbeitet und genutzt werden dürfen, § 1 Abs. 2 BDSG. Der
Begriff des "Umgangs" soll dabei lediglich als Oberbegriff für die 7 Phasen
des Erhebens, Speicherns, Veränderns, Übermittels, Sperrens, Löschens und
Nutzens stehen. Im Einzelnen lassen sich die Regelungen des BDSG wie folgt
aufteilen:
- 1. Abschnitt Allgemeine Bestimmungen §§ 1-11 BDSG
- 2. Abschnitt Datenverarbeitung der öffentlichen Stellen §§ 12-26
- 3. Abschnitt Datenverarbeitung der nicht-öffentlichen Stellen und
öffentlich-
rechtliche Wettbewerbsunternehmen §§ 27-38 a
- 4. Abschnitt Sondervorschriften §§ 39-42
- 5. Abschnitt Bußgeld-und Strafvorschriften §§ 43-44
- 6. Abschnitt Übergangsvorschriften §§ 45-46
Das Bundesdatenschutzgesetz gilt dabei für öffentliche Stellen des Bundes
und für die nicht-öffentlichen Stellen (Private), §§ 1 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 3
BDSG. Nur sehr eingeschränkt gilt es für die öffentlichen Stellen der
Länder, § 1 Abs. 2 Nr. 2 BDSG.
Öffentliche Stellen des Bundes sind nach § 2 Abs. 1 BDSG:
- Behörden des Bundes
- Organe der Rechtspflege des Bundes
- andere öffentlich-rechtlich organisierte Einrichtungen im Bundesbereich
(z. B. Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts
unter Bundesaufsicht)
- bestimmte Vereinigungen öffentlicher Stellen des Bundes und bestimmte von
diesen beherrschte Unternehmen, Gesellschaften oder Einrichtungen, auch in
privater Rechtsform
- nicht-öffentliche Stellen, soweit sie hoheitliche Aufgaben der
öffentlichen Verwaltung wahrnehmen, z.B. Schornsteinfeger oder TÜV
Öffentliche Stellen der Länder sind nach § 2 Abs. 2 BDSG:
- Behörden der Länder
- Organe der Rechtspflege der Länder
- andere öffentlich-rechtlich organisierte Einrichtungen im Landes-und
Kommunalbereich
- bestimmte Vereinigungen, Gesellschaften, Unternehmen und Einrichtungen
öffentlicher Stellen eines Landes, auch in privater Rechtsform, § 2 Abs. 3
BDSG
Nicht-öffentliche Stellen sind nach § 2 Abs. 4 BDSG:
- natürliche Personen
- privatrechtlich organisierte Unternehmen (z.B. AG, GmbH, GmbH & Co. KG,
OHG, KG)
- Personenvereinigungen des Privatrechts (z.B. Vereine, Verbände, politische
Parteien)
Nicht-öffentliche Stellen unterliegen dem BDSG aber nur, vgl. § 1 Abs. 2,
Nr. 3 BDSG:
- soweit sie die Daten unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen
verarbeiten, nutzen oder dafür erheben
- oder die Daten in oder aus nicht automatisierten Dateien verarbeiten,
nutzen oder dafür erheben
es sei denn, die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung erfolgt ausschließlich
für persönliche oder familiäre Tätigkeiten, § 1 Abs. 2, Nr. 3 BDSG.
Der zur Datenverarbeitungsanlage gleichgelagerte Begriff der "elektronische
Datenverarbeitung" stellt dabei die Bezeichnung für einen Computer dar. Ein
Computer ist dabei ein universell einsetzbares digitales System zur
programmgesteuerten, automatischen Verarbeitung von Daten. Zu beachten ist,
dass das BDSG auch für Daten in Akten und anderen Unterlagen z.B. Bücher,
Listen, Bildarchive, Filme, Videos, Tonaufzeichnungen gilt, soweit es sich
um personenbezogene Daten handelt, die offensichtlich aus einer
automatisierten Verarbeitung entnommen worden sind, § 27 Abs. 2 BDSG.
Europarecht
Auf europäischer Ebene kommt den Richtlinien, die datenschutzrechtliche
Bestimmungen enthalten eine große Bedeutung zu, da die Mitgliedstaaten diese
Richtlinien in nationales Recht transformieren müssen. Aus der
Datenschutzrichtlinie 95/46 EG des Europäischen Parlaments und des Rats vom
24.10.1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr . entstand das aktuelle
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).
Rechte des Betroffenen
Recht auf Auskunft
Jeder - unabhängig von Alter, Wohnsitz und Nationalität - hat das Recht auf
Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten (§ 34 BDSG). Dieses
Recht kann demnach auch von einem Arbeitnehmer gegenüber seinem Arbeitgeber
geltend gemacht werden. Welche Auskunft kann ein Arbeitnehmer verlangen?
- Über die zu seiner Person gespeicherten Daten, einschließlich der Angabe,
woher sie stammen und an welche dritten Stellen sie weitergegeben worden
sind
- Über den Zweck der Speicherung (d.h. die betreffende Verwaltungsaufgabe
oder den speziellen Geschäftszweck)
- Über Personen und Stellen, an die regelmäßig übermittelt wird (gilt nur
bei automatisierter Verarbeitung durch nicht-öffentliche Stellen)
Die Auskunft hat grundsätzlich schriftlich zu erfolgen und ist für den
Betroffenen kostenfrei (§ 34 Abs. 2 und § 34 Abs. 5 BDSG).
Benachrichtigung
Ein anderes wichtiges Mittel, damit man weiß, wer welche Daten über einen
verarbeitet, ist die Benachrichtigung. Gemäß § 33 Abs. 1 BDSG ist der
Betroffene zu benachrichtigen, wenn erstmals personenbezogene Daten über ihn
gespeichert oder an Dritte übermittelt werden. Diese Pflicht zur
Benachrichtigung entfällt insbesondere aber dann, wenn der Betroffene auf
andere Weise Kenntnis von der Speicherung oder Übermittlung erlangt hat (§33
Abs. 2 Nr. 1 BDSG) z.B. Speicherung der Stammdaten bei einem Arbeitnehmer.
Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung
Jede Stelle ist verpflichtet, unrichtige Daten zu berichtigen, wenn sich
z.B. bei dem Auskunftsanspruch eines Arbeitnehmers herausstellt, dass seine
personenbezogenen Daten unrichtig sind. Es liegt aber am Betroffenen selbst,
darauf hinzuweisen, wenn Daten unrichtig oder überholt sind.
Personenbezogene Daten eines Arbeitnehmers sind zu löschen, wenn
- die Speicherung unzulässig ist, weil schon die Erhebung unzulässig war §
35 Abs. 2 BDSG oder die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates nicht
beachtet worden sind
- es sich um Daten über rassische oder ethnische Herkunft, politische
Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen oder die
Gewerkschaftszugehörigkeit, gesundheitliche Verhältnisse oder das
Sexualleben, strafbaren Handlungen oder Ordnungswidrigkeiten handelt und die
speichernde Stelle deren Richtigkeit nicht beweisen kann
- für eigene Zwecke verarbeitete Daten für die Erfüllung des Speicherzwecks
nicht mehr erforderlich sind
Eine Löschung ist nur für personenbezogene Daten vorgesehen, die in einer
Datei verarbeitet werden, jedoch nicht für einzelne Daten, die in Akten
festgehalten sind. Sind allerdings komplette Akten unzulässig angelegt, so
sind sie ebenfalls zu vernichten; ebenso ist im Allgemeinen mit nicht mehr
erforderlichen Akten zu verfahren.
Was z.B. Personalakten anbelangt, so ergibt sich aus der Rechtsprechung des
Bundesarbeitsgerichts, dass diese Akten im Betrieb sorgfältig aufzubewahren
sind und nicht allgemein zugänglich sein dürfen. Hinsichtlich solcher Daten,
an der der Arbeitnehmer ein berechtigtes Interesse hat (z.B.
Gesundheitszustand, persönliche Verhältnisse, Einkommen) trifft den
Arbeitgeber eine Verschwiegenheitspflicht. Eine Verletzung dieser
Verschwiegenheitspflicht kann zum Schadensersatz verpflichten. Gesetzliche
Regelungen der arbeitgeberseitigen Verschwiegenheitspflicht finden sich z.
B. in § 5 BDSG oder in § 5 Mutterschutzgesetz.
Personenbezogenen Daten sind immer dann zu sperren, wenn einer fälligen
Löschung besondere Gründe entgegenstehen, etwa
- gesetzlich, satzungsmäßig oder vertraglich festgelegte
Aufbewahrungsfristen
- schutzwürdige Interessen des Betroffenen, etwa weil die Beweismittel
verloren gingen
- ein unverhältnismäßig hoher Aufwand wegen der besonderen Art der
Speicherung besteht
Personenbezogene Daten sind zu sperren, wenn der Betroffene ihre Richtigkeit
bestreitet und sich weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit feststellen
lässt. Gesperrte Daten dürfen ohne Einwilligung des Betroffenen nur
übermittelt oder genutzt werden, wenn dies
- zu wissenschaftlichen Zwecken
- zur Behebung einer bestehenden Beweisnot
- aus sonstigen im überwiegenden Interesse der speichernden Stelle oder
eines Dritten liegenden Gründen unerlässlich ist
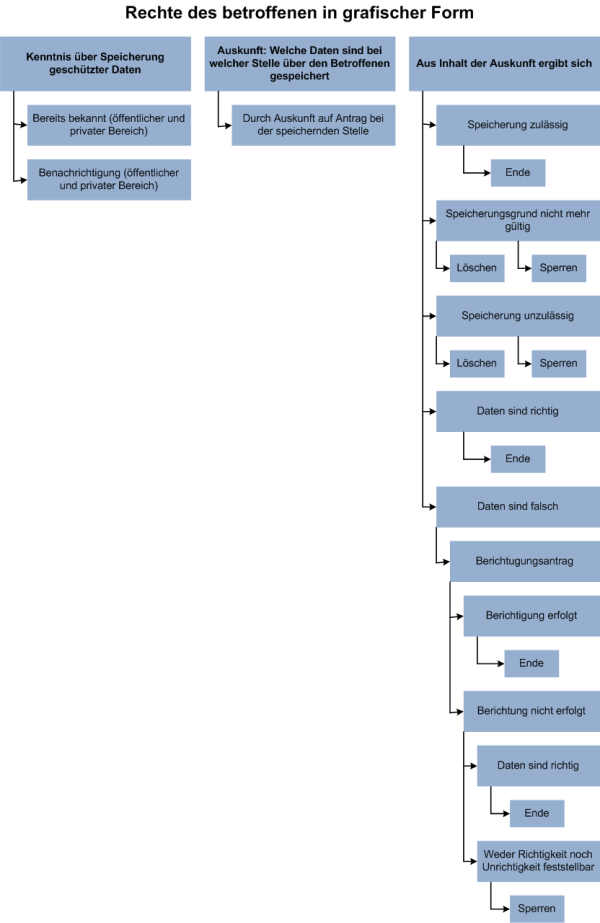 Technische und organisatorische Maßnahmen zum Datenschutz
Technische und organisatorische Maßnahmen zum Datenschutz
Nach § 9 BDSG haben öffentliche und nicht-öffentliche Stellen, die selbst
oder im Auftrag personenbezogene Daten erheben, verarbeiten oder nutzen, die
technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, die erforderlich
sind, um die Ausführung der Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu
gewährleisten. Es muss daher gewährleistet werden können, dass
personenbezogenen Daten vor Missbrauch, Fehlern und Unglücksfällen möglichst
sicher sind. Welche Maßnahmen dafür notwendig sind, hängt nicht nur von der
Art der Daten ab, sondern ebenso von der Aufgabe, den organisatorischen
Bedingungen, den räumlichen Verhältnissen, der personellen Situation und
anderen Rahmenbedingungen. Die technischen und organisatorischen Maßnahmen
sollen insbesondere folgende Maßnahmen umfassen:
Zutrittskontrolle
Nr. 1 der Anlage zu § 9: Dadurch soll sichergestellt werden, dass
Unbefugte kein Zugang haben (körperlich) zu Datenverarbeitungsanlagen, mit
denen personenbezogene Daten verarbeitet werden. Es soll damit die
Möglichkeit unberechtigter Einsicht-oder Veränderungsmöglichkeit verhindert
werden.
Zugangskontrolle
Nr. 2 der Anlage zu § 9: Die Zugangskontrolle soll sicherstellen, dass
nicht in das EDV-System selbst seitens hierzu nicht befugter Personen
eingedrungen werden kann.
Zugriffskontrolle
Nr. 3 der Anlage zu § 9: Die Zugriffskontrolle soll gewährleisten, dass
ein grundsätzlich zur Benutzung eines Datenverarbeitungssystems
Berechtigter, nur auf die Daten zugreifen kann, auf die sich seine
Berechtigung bezieht.
Weitergabekontrolle
Nr. 4 der Anlage zu § 9: Diese soll verhindert, dass Datenträger unbefugt
gelesen, kopiert, verändert, oder entfernt werden können. Ferner soll
überprüft werden können, an welche Stellen eine Übermittlung
personenbezogenen Daten durch Einrichtungen zur Datenübertragung vorgesehen
ist.
Eingabekontrolle
Nr. 5 der Anlage zu § 9: Es muss nachträglich überprüft und festgestellt
werden können, welche Daten von wem in Datenverarbeitungsanlagen eingegeben,
verändert oder gelöscht bzw. entfernt worden sind.
Auftragskontrolle
Nr. 6 der Anlage zu § 9: Hiermit soll sichergestellt werden, dass die im
Auftrag zu verarbeitenden Daten nur entsprechend den Weisungen des
Auftraggebers verarbeitet werden.
Verfügbarkeitskontrolle
Nr. 7 der Anlage zu § 9: Stellt eine Sicherungsverpflichtung dar und soll
den Schutz vor zufälliger Zerstörung (Brand, Blitzschlag, Wasser etc.)
gewährleisten.
Trennungsgebot
Nr. 8 der Anlage zu § 9: Dieses soll die zweckbestimmte Verarbeitung
personenbezogener Daten auch technisch sicherstellen. Dieses Gebot verlangt
aber keine räumliche Trennung der Daten in unterschiedlichen
Datenverarbeitungsanlagen. Bei den technischen und organisatorischen
Maßnahmen ist von entscheidender Bedeutung, dass sie als ein
zusammenwirkendes Schutzsystem verstanden werden. Viele Maßnahmen des
Datenschutzes wirken zugleich im Sinne einer Sicherung eines ordentlichen
Betriebsablaufs. Deshalb ist es wichtig, dass Datenschutzkonzept jeweils in
engem Zusammenhang mit sonstigen Sicherheitskonzepten zu entwickeln und
anzuwenden.
Aufgaben, Rechte und Pflichten des Datenschutzbeauftragten
Öffentliche und nicht-öffentliche Stellen, die personenbezogene Daten
automatisiert erheben, verarbeiten oder nutzen, sind verpflichtet, bei
diesen Arbeiten die Ausführungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie
anderer Vorschriften über den Datenschutz sicherzustellen. Der
Datenschutzbeauftragte ist Organ der Selbstkontrolle; er unterstützt und
berät das Unternehmen.
Nach § 4f Abs. 1 BDSG haben nicht-öffentliche Stellen, hierunter fallen z.B.
alle Unternehmen der privaten Wirtschaft, aber auch freiberuflich Tätige,
egal welcher Rechtsform sie angehören, einen "betrieblichen" Beauftragten
für den Datenschutz (bDSB) schriftlich zu bestellen, wenn
- bei der automatisierten Datenverarbeitung mindestens 10 Arbeitnehmer oder
- bei Verarbeitung auf andere Weise mindestens 20 Personen beschäftigt sind
Unabhängig von der Anzahl der Arbeitnehmer haben nicht-öffentliche Stellen
einen bDSB zu bestellen, soweit sie
- automatisierte Verarbeitungen vornehmen, die einer Vorabkontrolle
unterliegen oder
- personenbezogene Daten geschäftsmäßig zum Zwecke der Übermittlung oder der
anonymisierten Übermittlung erheben, verarbeiten oder nutzen. Mit dieser
Aufgabe kann auch eine (natürliche) Person außerhalb der verantwortlichen
Stelle betraut werden (§ 4f Abs. 2 S. 2 BDSG), sog. externer
Datenschutzbeauftragter
Der bDSB ist innerhalb einer Frist von einem Monat nach Aufnahme der
Tätigkeit der nichtöffentlichen Stelle zu bestellen. Wird der betriebliche
Datenschutzbeauftragte vorsätzlich oder fahrlässig nicht oder nicht
rechtzeitig bestellt, so stellt dies eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit
einer Geldbuße von bis zu 25.000 EUR geahndet werden kann.
Zum Beauftragten für den Datenschutz darf nur bestellt werden, wer die zur
Erfüllung seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit
besitzt (§4f Abs. 2 S. 1 BDSG).
Fachkunde
Die erforderliche Fachkunde umfasst sowohl das allgemeine Grundwissen
hinsichtlich des Datenschutzrechts sowie über Verfahren und Techniken der
automatisierten Datenverarbeitung, als auch die Kenntnis über
betriebswirtschaftliche Zusammenhänge. Darüber hinaus muss der oder die bDSB
mit der Organisation und den Funktionen seines Betriebes vertraut sein,
namentlich einen Überblick über alle Fachaufgaben haben, zu deren Erfüllung
personenbezogene Daten verarbeitet werden.
Zuverlässigkeit
Der Begriff der Zuverlässigkeit wird neben Umschreibungen wie sorgfältige
und gründliche Arbeitsweise, Belastbarkeit, Lernfähigkeit, Loyalität und
Gewissenhaftigkeit hauptsächlich mit der Frage der Inkompatibilität der
Aufgabe des Datenschutzbeauftragten mit anderen hauptamtlichen Aufgaben des
Datenschutzbeauftragten in Verbindung gebracht. Wird ein Arbeitnehmer eines
Unternehmens nur nebenamtlich mit der Aufgabe des bDSB betraut, so stellt
sich das Problem einer eventuellen Interessenkollision, die seine vom Gesetz
geforderte Zuverlässigkeit in Frage stellen kann. Darüber hinaus sollen auch
Personen nicht zu Datenschutzbeauftragten berufen werden, die in dieser
Funktion in Interessenkonflikte geraten würden, die über das unvermeidliche
Maß hinausgehen. Unvereinbar wäre es z.B., den Inhaber, den Vorstand, den
Geschäftsführer oder den sonstigen gesetzlichen oder verfassungsmäßig
berufenen Leiter zu bestellen, da sie sich nicht wirksam selbst
kontrollieren können. Weiter ist zu vermeiden, Personen zu
Datenschutzbeauftragten zu bestellen, die von ihrer Stellung im Betrieb für
die Datenverarbeitung verantwortlich sind (Betriebsleiter, Leiter der EDV).
Dagegen kommen als Datenschutzbeauftragte beispielsweise Mitarbeiter/-innen
der Revision, der Rechtsabteilung und Organisation in Frage.
Bestellung
Die Bestellung zum Beauftragten für den Datenschutz kann in entsprechender
Anwendung von § 626 BGB, auch auf Verlangen des Landesbeauftragten für den
Datenschutz, widerrufen werden (§ 4f Abs. 3 S. 4 BDSG). Eine solche
Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
begründet sich u.a. dann, wenn Tatsachen vorliegen, auf Grund derer, unter
Berücksichtigung aller. Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der
Interessen beider Vertragsteile, die Fortsetzung der Tätigkeit nicht
zugemutet werden kann, weil z.B. der oder die Beauftragte für den
Datenschutz nicht die erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzt.
Der oder die Datenschutzbeauftragte wirkt auf die Einhaltung des SDSG und
anderer Vorschriften über den Datenschutz hin. Zu diesem Zweck kann sich der
oder die Beauftragte für den Datenschutz in Zweifelsfällen an den
Landesbeauftragten für den Datenschutz wenden. Ihm bzw. ihr obliegen
insbesondere
- die Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung der
Datenverarbeitungsprogramme, mit deren Hilfe personenbezogene Daten
verarbeitet werden; zu diesem Zweck ist der bOSS über Vorhaben der
automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten rechtzeitig zu
unterrichten (§ 4g Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 SDSG)
- die Schulung der bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen
Personen durch geeignete Maßnahmen mit den Vorschriften dieses Gesetzes
sowie anderen Vorschriften über den Datenschutz und mit den jeweiligen
besonderen Erfordernissen des Datenschutzes vertraut zu machen ( § 4g Abs. 1
Satz 3 Nr. 2 BDSG). Dies kann z.B. in schriftlicher Form, durch
Schulungsveranstaltungen oder auch durch Anregungen und Informationen im
Rahmen von Dienstbesprechungen erfolgen
Der Beauftragte für den Datenschutz ist dem Leiter der nicht öffentlichen
Stelle unmittelbar zu unterstellen. Er ist in Ausübung seiner Fachkunde auf
dem Gebiet des Datenschutzes weisungsfrei und darf wegen der Erfüllung
seiner Aufgaben nicht benachteiligt werden (§ 4f Abs. 3 BDSG).
Der Beauftragte für den Datenschutz ist ferner zur Verschwiegenheit über die
Identität des Betroffenen sowie über Umstände, die Rückschlüsse auf den
Betroffenen zulassen, verpflichtet, soweit er nicht davon durch den
Betroffenen befreit wird (§ 4f Abs. 4 BDSG).
Die datenverarbeitende Stelle ist verpflichtet, den Datenschutzbeauftragten
bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen und ihm insbesondere,
soweit dies zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist, Hilfspersonal
sowie Räume, Einrichtungen, Geräte und Mittel zur Verfügung zu stellen (§ 4f
Abs. 5 BDSG). Zur Bewältigung seiner Aufgabe ist dem Beauftragten für den
Datenschutz von der verantwortlichen Stelle eine Übersicht über die
meldepflichtigen Angaben sowie über zugriffsberechtigte Personen zur
Verfügung zu stellen (§ 4g Abs. 2 S. 1 BDSG).
Der oder die Beauftragte für den Datenschutz ist zuständig für die
Vorabkontrolle (§ 4d Abs. 6 BDSG), d.h. soweit automatisierte Verarbeitungen
besondere Risiken für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen aufweisen,
sind diese vor Beginn der Verarbeitung einer Prüfung zu unterziehen. Die
Vorabkontrolle hat der oder die Beauftragte für den Datenschutz nach Empfang
der Übersicht über die meldepflichtigen Angaben sowie über
zugriffsberechtigte Personen vorzunehmen. In Zweifelsfällen hat er sich an
die Aufsichtsbehörde zu wenden.
Adressen der Datenschutzkontrollinstitutionen
Bundes-und Landesdatenschutzbeauftragte (Auszug auf Landesebene) und
regionale Aufsichtsbehörde für den nicht-öffentlichen Bereich:
Bund
Der Bundesbeauftragte für Datenschutz
Postfach 20 01 12
53173 Bonn (Bad Godesberg)
Telefon: (02 28) 8 19 95-0
Telefax: (02 28) 8 19 95-5 50
E-Mail:
poststelle@bfd.bund400.de
Internet:
www.bfd.bund.de
Baden-Württemberg
Der Landesbeauftragte für Datenschutz
Marienstraße 12
70178 Stuttgart
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
Telefon: (07 11) 61 55 41-0
Telefax: (07 11) 61 55 41-15
E-Mail:
poststelle@lfd.bwl.de
Aufsichtsbehörde
Innenministerium Baden Württemberg Aufsichtsbehörde für Datenschutz im
nicht-öffentlichen Bereich
Dorotheenstraße 6
70020 Stuttgart
Telefon: (07 11) 2 31-4
Telefax: (07 11) 2 31-32 99
Adressen von Datenschutzorganisationen
Mit der Umsetzung des grundrechtlichen Datenschutzes beschäftigen sich auch
verschiedene Organisationen:
DVD
Die Deutsche Vereinigung für Datenschutz (DVD) stellt den Bürgerschutz vor
stattlichen Eingriffen in den Vordergrund
Bonner Talweg 33-35
53113 Bonn
Telefon: (02 28) 22 24 98
E-Mail:
dvd@aktiv.org
DGRI
Die Deutsche Gesellschaft für Recht und Informatik (DGRI) befasst sich mit
den rechtlichen Problemen der DV generell (z. B. Softwareschutz)
Schöne Aussicht 30
61348 Bad Homburg
Telefon: (0 61 72) 92 09 30
Telefax: (0 61 72) 92 09 33
GDD
Für betriebliche und behördliche Datenschutzbeauftragte sind die
Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherung (GDD)
Pariser Straße 37
53117 Bonn
Telefon: (02 28) 69 43 13
Telefax: (02 28) 69 56 38
E-Mail:
info@gdd.de
BvD
Der Berufsverband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands (BvD) von
Interesse:
Hegemannsweg 32
45966 Gladbeck
Telefon: (0 20 43) 2 33 44
Telefax: (0 20 43) 29 56 02
Internet:
www.bvdnet.de
Tipps und Tricks
Aufgaben-Katalog für den betrieblichen Datenschutzbeauftragten
Aufgaben, die nach dem BDSG zu übertragen sind:
- Koordinierung aller Datenschutz-Maßnahmen, Abstimmung mit der
Geschäftsleitung, Einschaltung der Aufsichtsbehörde bei Bedarf (§ 4g Abs. 1)
- Führen von Übersichten (die im Betrieb zur Verfügung zu stellen sind)
über -eingesetzte DV-Anlagen -Bezeichnung und Art der Dateien -Art der
gespeicherten Daten -Geschäftszwecke zu deren Erfüllung die Kenntnis der
Daten erforderlich ist -deren regelmäßige Empfänger -zugriffsberechtigte
Personengruppen
- Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung der Datenverarbeitungs-Programme
- Sicherstellung einer Programmdokumentation
- Bekanntgabe der Vorschriften an die in der Datenverarbeitung tätigen
Personen
- Beratende Mitwirkung zur Stellenbesetzung der in der DV arbeitenden
Personen
- Verpflichtung auf das Datengeheimnis
- Überwachung und Koordination der Datensicherungsmaßnahmen nach § 9 BDSG
Aufgaben, die nach dem BDSG übertragen werden können:
- Erstellen eines Katalogs für die nach dem BDSG geschützten Daten
- Mitwirkung bei der Benachrichtigungen und Auskünften nach §§ 33,34 BDSG
- Mitwirken bei der Gestaltung von Vordrucken für personenbezogene Daten
- Überwachung der Auswahl des Auftragnehmers § 11 Abs. 2 BDSG
- Verantwortlichkeit für den Abschluss von Versicherungen im EDV-Bereich
- Ausgestaltung der Hinweispflicht an die Datenempfänger zur Zweckbindung
Aufgaben, die wegen des Sachzusammenhangs, der Auslastung und der Kosten
zusätzlich übertragen werden sollen:
- Überwachung der Geheimhaltung von Daten, die vom Schutz des BDSG nicht
umfasst sind aber im Betriebsinteresse liegen
- Erarbeitung eines Sicherungssystems für die gesamte Datenverarbeitung
Zusätzliche Aufgaben bei geschäftsmäßiger Datenverarbeitung:
- Mitwirkung bei der Meldepflicht und zwar bei Aufnahme, Änderung oder
Beendigung der Tätigkeit
- Überwachung der Einhaltung der Weisungen des Auftraggebers § 11 BDSG
- Mitwirkung bei der Bestimmung des Entgelts § 34 Abs. 5 S. 2 BDSG
zurück zum Beitragsanfang


Markieren Sie den Inhalt der Textbox und kopieren Sie ihn in Ihre Website
 Die Geschichte des Datenschutzes ist eine noch sehr kurze Geschichte. Dies
steht im direkten Zusammenhang mit der erst in jüngerer Zeit scheinbar
unaufhaltsam voranschreitenden technischen Entwicklung im Bereich der
Informationstechnologie. Erste Überlegungen zum Datenschutz kamen Anfang der
60 Jahre auf, als man sich bewusst wurde, dass der zunehmenden Möglichkeit
der technischen Datenverarbeitung die Schaffung beschränkender Bestimmungen
einhergehen muss, damit die schutzwürdigen Belange des Einzelnen bei der
Verarbeitung seiner Daten nicht beeinträchtigt werden.
Die Geschichte des Datenschutzes ist eine noch sehr kurze Geschichte. Dies
steht im direkten Zusammenhang mit der erst in jüngerer Zeit scheinbar
unaufhaltsam voranschreitenden technischen Entwicklung im Bereich der
Informationstechnologie. Erste Überlegungen zum Datenschutz kamen Anfang der
60 Jahre auf, als man sich bewusst wurde, dass der zunehmenden Möglichkeit
der technischen Datenverarbeitung die Schaffung beschränkender Bestimmungen
einhergehen muss, damit die schutzwürdigen Belange des Einzelnen bei der
Verarbeitung seiner Daten nicht beeinträchtigt werden.